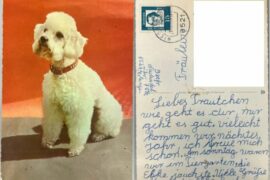Vom 29. bis 31. August fand die GAIN-Tagung statt, die größte deutsch-nordamerikanische Wissenschaftskonferenz. Mit dabei waren auch die Universität und die Universitätsmedizin Göttingen. Wir fragen Vizepräsidentin Professor Dr. Hanewinkel nach ihren Eindrücken:
Die jährlich von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Alexander-von-Humboldt-Stiftung und dem Deutschen Akademischen Austauschdienst organisierte Tagung fand 2025 in Boston statt. Mit welchen Erwartungen sind Sie nach Boston gefahren? Welche Eindrücke haben Sie von der Tagung mitgenommen?
Ich bin mit der klaren Erwartung nach Boston gereist, gezielte Gespräche mit Postdocs über ihre Karriereplanung zu führen und konkrete Stellenangebote aus Göttingen vorzustellen. Dank des Online-Portals konnten wir bereits im Vorfeld Termine mit interessierten Wissenschaftler*innen vereinbaren – das hat hervorragend funktioniert. Gemeinsam mit Patricia Nehring war ich am Messestand der Universität Göttingen aktiv, wir hatten durchgehend Gespräche mit potenziellen Bewerber*innen.
Besonders bereichernd war auch die gemeinsame Lunch-Session, die wir mit der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) als Gastgeber ausgerichtet haben – eine gute Gelegenheit, um mit internationalen Forschenden ins Gespräch zu kommen und gleichzeitig unsere Kooperation innerhalb des Göttingen Campus sichtbar zu machen.
Hervorzuheben ist in diesem Jahr auch die starke Unterstützung des Landes Niedersachsen: Mit insgesamt elf Hochschulen und der VolkswagenStiftung waren wir auf der GAIN vertreten – das ist ein wichtiges politisches Signal. Minister Falko Mohrs war persönlich vor Ort. Das hat nicht nur unsere Gespräche mit Partnern vor Ort gestärkt, sondern auch ein klares Zeichen gesetzt: Niedersachsen steht für Wissenschaftsfreiheit und internationale Zusammenarbeit. Der Austausch mit Kolleg*innen, Partnerinstitutionen und politischen Vertreter*innen war mir wichtig – und es war großartig, das alles auf der Tagung realisieren zu können.
Mein Gesamteindruck: Eine rundum gelungene und sehr gut organisierte Veranstaltung – gerade in politisch herausfordernden Zeiten. Es wurde deutlich, wie entscheidend es ist, dass wir unsere Arbeit international, vernetzt und mit klarer Haltung fortsetzen.
Die GAIN dient vor allem der Information von Nachwuchswissenschaftler*innen über Karrierechancen im deutschen Wissenschaftssystem. In diesem Jahr war jedoch manches anders als bei vorangegangenen Tagungen. Vor dem Hintergrund der massiven Kürzungen und Einschränkungen der Wissenschaft in den USA waren erstmals auch internationale, aktuell in Nordamerika forschende Postdocs dazu aufgerufen, an der Tagung mitzuwirken. Wie hat sich das im Programm widergespiegelt? Wie würden Sie die Stimmung beschreiben?
Die Stimmung war geprägt von Unsicherheit. Viele Wissenschaftler*innen, mit denen wir gesprochen haben, äußerten Sorgen – etwa hinsichtlich fehlender rechtlicher Absicherung oder politischem Druck. Besonders eindrücklich war das Gespräch mit einer Wissenschaftlerin in gleichgeschlechtlicher Partnerschaft, die offen über ihre Ängste sprach. Das zeigt, wie sehr politische Entwicklungen den Alltag von Forschenden beeinflussen – auch abseits der Labore und Universitäten.
Das Programm der GAIN hat sensibel reagiert: Es gab mehr Vorträge auf Englisch, eine deutlich internationale Ausrichtung, und Formate mit Raum für offenen Austausch. Die GAIN war in diesem Jahr mehr denn je auch ein Forum für Offenheit, Sicherheit und Perspektive – das war gut und notwendig.




Die Bundesregierung hat als Zeichen für Wissenschaftsfreiheit ein 1.000-Köpfe-Plus-Programm aufgelegt, das darauf zielt, den Wissenschaftsstandort Deutschland für internationale Forschende attraktiv zu machen. Welche Bedeutung hat das Programm für die Universität Göttingen?
Das 1.000‑Köpfe‑Plus‑Programm ist für uns ein außerordentlich wertvolles Instrument, weil es bestehende Förderungen gezielt aufstockt – etwa für bessere Ausstattung, zusätzliche Mittel für Personal oder familienfreundliche Rahmenbedingungen. Es handelt sich nicht um eine eigenständige Vollförderung, sondern um eine ergänzende Maßnahme, die von der gastgebenden Einrichtung beantragt wird. Damit können wir internationale Talente gezielt unterstützen und ihnen zeigen: Wir investieren in deine Karriere und deinen Weg hier vor Ort.
In Göttingen nutzen wir diese Möglichkeit aktiv, um individuelle Karrierewege zu fördern – auch über Professuren hinweg. Bei der GAIN wurden wir häufig gefragt: „Was kann ich tun, wenn gerade keine Professur offen ist?“ Wir haben geantwortet: Es gibt viele gute Wege. Zum Beispiel über Positionen als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, mit einer eigenen Nachwuchsgruppe oder durch Drittmittelprojekte – zum Beispiel über einen ERC Starting Grant, ein Marie‑Curie‑Fellowship oder andere Förderformate.
Außerdem betonen wir: Man sollte sich nicht entmutigen lassen, wenn ein Antrag beim ersten Mal nicht erfolgreich ist. Mehrere Anläufe sind völlig normal – und lohnen sich. Unter bestimmten Bedingungen ist eine Kombination mit 1.000‑Köpfe‑Plus‑Mitteln möglich. Wir als Standort sind gefragt, dafür transparente Wege und gute Beratung bereitzustellen.
Internationale Wettbewerbsfähigkeit gerät zunehmend in den Fokus deutscher Hochschulen. Welche Chancen und welche Herausforderungen sehen Sie für den Forschungsstandort Deutschland? Wie ordnen Sie die Universität Göttingen dabei ein?
Eine der größten Herausforderungen im deutschen Wissenschaftssystem ist die Struktur der akademischen Laufbahn: Je höher Forschende aufsteigen, desto schmaler wird der Pfad. Wir müssen frühzeitig zeigen, dass eine Karriere außerhalb der Professur kein Rückschritt ist – sondern ein Plan A sein kann. Der Wechsel in die Industrie, ins Wissenschaftsmanagement oder zu Stiftungen bietet vielfältige Möglichkeiten. Auch im Start-up-Bereich haben wir großes Potenzial, das wir noch nicht voll ausschöpfen. Hier können wir durchaus von den USA lernen: mehr Mut, mehr Flexibilität, weniger Hierarchie.
Deutschland muss insgesamt progressiver, ganzheitlicher denken – von der Familienfreundlichkeit über Stadtentwicklung bis hin zur Gleichstellung. Gerade für internationale Talente sind Lebensqualität, bezahlbarer Wohnraum, Partnerjobs, Kinderbetreuung und langfristige Perspektiven für Menschen in Partnerschaften oder mit Familie entscheidende Standortfaktoren. Göttingen kann hier durch seine Überschaubarkeit und den starken Campus punkten – aber wir müssen unsere Stärken deutlicher herausstellen und gezielter kommunizieren.
Unser Ziel muss sein: nicht nur Talente zu rekrutieren, sondern sie auch langfristig zu halten. Das bedeutet, Strukturen mitzugestalten, die stärken.
Was ich mir konkret wünsche: Dass wir in Göttingen gemeinsam mit Stadt, Campus und Industrie die Attraktivität für internationale Forschende weiter steigern – etwa durch mehr Zusammenarbeit, Best-Practice Beispiele, gute Beratung und die Weiterentwicklung unserer Strukturen, die konkret auf die langfristige Integration von Wissenschaftler*innen und Familien ausgerichtet sind.