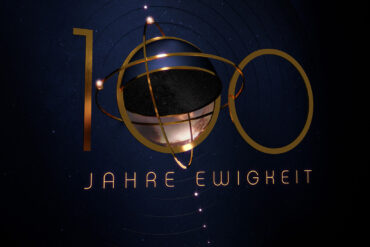Die Göttinger Agrarwissenschaften erforschen die Zukunft der Landwirtschaft unter den Bedingungen des Klimawandels. Prof. Dr. Achim Spiller, Dekan der Fakultät für Agrarwissenschaften, gibt hier Einblicke, welche innovativen Wege Göttingen einschlägt.
Herr Spiller, vor welchen wesentlichen Herausforderungen steht die zukünftige Landwirtschaft?
Seit der Corona-Pandemie, dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine und der hohen Inflation steht wieder das Thema Ernährungssicherung auf der öffentlichen Agenda. Haben wir genügend Lebensmittel, und sind diese bezahlbar? Gleichzeitig haben wir die Klimakrise, die Biodiversitätsverluste und die Tierwohlproblematik, mit der sich der Sektor beschäftigen muss. Diese Gleichzeitigkeit ist auch für die Forschung eine große Herausforderung, weil es dabei natürlich auch Zielkonflikte gibt.
Mit welchem Fokus wird dazu in Göttingen geforscht?
Wir haben dafür an unserer Fakultät drei gut aufgestellte Departments: das deutschlandweit größte agrarökonomische Department, das Department für Nutzpflanzenwissenschaften im Spannungsfeld von Ernährungssicherung und Ökologie und die Nutztierwissenschaften mit einem jungen, schwungvollen Kollegium, das mit besonderen ethischen Herausforderungen konfrontiert ist. Ein besonderer Vorteil ist auch die Forst-Fakultät als Partner hier direkt vor Ort. Gleichzeitig haben wir in der Region mit dem Thünen-Institut in Braunschweig, dem Julius Kühn-Institut in Quedlinburg, dem Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gatersleben und unserer Partner-Fakultät der Universität Kassel in Witzenhausen starke Kooperationspartner. Gemeinsam entwickeln wir das südliche Niedersachsen auch europaweit als einen der Schwerpunkte für eine nachhaltige Landnutzungsforschung.
Der Fokus unseres neuen Verbundprojekts agri:change liegt auf der Transformation der Tierhaltung. Denn jedes zweite Hühnchen und jedes dritte Schwein in Deutschland steht in Niedersachsen mit der Intensivtierhaltung in der Region Vechta-Cloppenburg. In dem Projekt arbeiten wir eng mit der Tierärztlichen Hochschule Hannover zusammen. Diese ist neben dem Deutschen Institut für Lebensmitteltechnik in Quakenbrück auch Partner in unserem Projekt Zukunft Ernährung Niedersachsen, in dem es unter anderem um alternative Produkte geht.
Das neue Forschungsgewächshaus auf dem Nordcampus ist bezogen, die Mittel für den Forschungsneubau AgriFutur sind bewilligt. Wie verbessern sich die Bedingungen, können so auch neue Fragen untersucht werden?
Die Agrarwissenschaften sind eine angewandte Disziplin, wir möchten also, dass unsere Ergebnisse später in der Praxis eine Rolle spielen. Dafür ist es notwendig, dass wir auf verschiedenen Skalenebenen forschen – vom Labor über das Gewächshaus bis zum Feld.
In unserem modernen Gewächshaus können wir ganz verschiedene Temperaturregime kontrollieren, können im Winter heizen, aber die Pflanzen im Sommer auch kühlen. Im neuen Forschungsbau AgriFutur wollen wir unter sehr kontrollierten Bedingungen die zukünftigen Extremsituationen des Klimawandels hier bei uns, in den Tropen oder anderen Regionen simulieren. Dann untersuchen wir, was das für die Pflanzen und auch für die Tiere bedeutet.
In einem weiteren Labor im Forschungsneubau können wir per virtueller Realität verschiedene Umgebungen schaffen, in denen Verbraucher*innen im Supermarkt oder im Bistro und Landwirt*innen auf dem Trecker Entscheidungen treffen. Wir wollen zum Beispiel erproben, wie sich das Ernährungsverhalten von Menschen ändert, wenn es immer wärmer wird. Wie werden sie Waren auswählen und mit welchen Informationen können wir darauf Einfluss nehmen? In der Landwirtschaft wird die teilflächenspezifische Bearbeitung von Feldern mit Robotern und automatisierten KI-gestützten Entscheidungssystemen zunehmend eine bedeutende Rolle spielen. Welchen Einfluss der Landwirt dann noch nimmt und wie er damit umgehen wird, das wollen wir mithilfe der Simulationen prognostizieren.
Eine solche Laboranalyse brauchen wir, weil wir ja nicht warten können, bis sich Veränderungen im Feld und im Klimawandel tatsächlich zeigen. Wir müssen diese Bedingungen vorher durchdenken.
Die Langfassung des Interviews lesen Sie in der Universitätszeitung uni|inform Oktober 2025 auf Seite 5: www.uni-goettingen.de/uniinform